Blog
Aktuelle Einträge
10. September 2018 — West-Literatur in Ost-Bibliotheken

Wie gut war die westdeutsche Literaturproduktion während der 50er und 60er Jahre in wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR präsent?
Der Beschaffung von Literatur aus dem Westen standen zwei wesentliche Hindernisse entgegen: Zum einen waren die finanziellen Ressourcen, insbesondere die Devisen, für den Ankauf westdeutscher Literatur äußerst begrenzt. Zum anderen bezweifelte die Sozialistische Einheitspartei (SED) die Notwendigkeit, Bücher und Zeitschriften des »Klassenfeindes« in größerem Umfang überhaupt zugänglich zu machen.
Auf jeden Fall sollten Texte ausgeschlossen sein, die »militaristischen«, »imperialistischen«, »revisionistischen«, »revanchistischen« oder »klerikalfaschistischen« Inhalts – so die Terminologie, wenn vom »Klassenfeind« die Rede war – oder die gegen die Freundschaft mit der Sowjetunion gerichtet waren. Irgendeiner dieser Vorwürfe traf auf nahezu jede westliche Publikation zu. Nur die technisch-wissenschaftliche Literatur war davon ausgenommen: Sie ließ in der Regel keine politische Tendenz erkennen.
Die Erwerbungen, die die 15 wichtigsten wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR getätigt haben, sind zwischen 1955 und 1963 von 76.585 auf 102.997 Titel insgesamt gestiegen. Da aber die Gesamterwerbungen noch kräftiger gewachsen sind, fällt der Anteil der Erwerbungen aus Westdeutschland und Berlin von 29 auf 24 Prozent. Auch in der späteren DDR-Zeit wird die Quote der fünfziger Jahre nicht mehr erreicht. In den fünfziger Jahren war die Lage noch vergleichsweise gut.
Gleichzeitig muss man in Rechnung stellen, dass die durchschnittlichen Ausgaben für den Bücherkauf bei einer ostdeutschen Universitätsbibliothek im Jahr 1963 bei 202.000 M lagen. Im Vergleich dazu hat eine westdeutsche Universitätsbibliothek im selben Jahr durchschnittlich 471.000 DM ausgegeben. Dieses Geld konnte uneingeschränkt auch für den Erwerb auf dem internationalen Buchmarkt verwendet werden. Die Kaufkraft der ostdeutschen Universitätsbibliotheken war vergleichsweise niedrig.
Ein anderer Maßstab zur Beurteilung der Frage, ob 24 % Westpublikationen nun viel oder wenig sind, ist die Anzahl der Neuerscheinungen des Buchhandels in Ost und West. Im Osten stieg die Titelproduktion von 2.480 (1950) allmählich auf 6.073 (1989) an, im Westen von 13.181 (1950) auf 65.980 (1989). Wollten die Bibliotheken also den gleichen repräsentativen Ausschnitt aus dem Buchmarkt in ihren Buchbeständen widerspiegeln, hätte dem Wachsen der westdeutschen Produktion um das Fünffache viel stärker Rechnung getragen werden müssen.
Gemessen am starken Interesse auf Seiten der Benutzer und gemessen an der Fülle erwerbungswürdiger Literatur, die keine abzulehnende politische Tendenz hatte, kann man nicht davon sprechen, dass die Bibliotheken der DDR einen ausreichenden Bestand an West-Publikationen angeboten hätten.
Die Bibliothekare saßen zwischen allen Stühlen: den Erwartungen der Partei, der grotesken Bürokratie und den enttäuschten Lesern. Ihrem Berufsethos hätte es entsprochen, den Lesern ein vielfältiges Literaturangebot unzensiert anzubieten. Aber bei dem Versuch, Publikationen aus dem westlichen Deutschland zu beschaffen, gerieten sie unweigerlich mitten hinein in die ideologischen Kämpfe um den »Sieg des Sozialismus«. Im Ergebnis hatten die Benutzer der DDR-Bibliotheken nur stark eingeschränkte Möglichkeiten, über den staatlich definierten Tellerrand hinauszublicken.
Ausführlich nachzulesen bei Michael Knoche: West-Literatur in Ost-Bibliotheken. Die Präsenz der westdeutschen Literaturproduktion in wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR. In: Buch und Bibliothek im Wirtschaftswunder. Entwicklungslinien, Kontinuitäten und Brüche in Deutschland und Italien während der Nachkriegszeit (1949–1965). Herausgegeben von Klaus Kempf und Sven Kuttner. Wiesbaden: Harrassowitz 2018, S. 73–85 (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen Bd. 63)
Michael Knoche
02. September 2018 — Die Menschenkette in der Brandnacht

Immer wieder, besonders aber wenn sich der 2. September 2004 jährt, muss ich an den Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zurückdenken. Von einer einzigen Episode will ich berichten.
Nachdem zahlreiche Bibliothekare und Restauratoren schon gegen 20.40 Uhr am Unglücksort eingetroffen waren und mit der Evakuierung von Kunstwerken und Büchern aus dem brennenden Gebäude begonnen hatten, kam es etwa 90 Minuten später zu einer völligen Sperrung des Hauses durch die Feuerwehr. Der Einsatzleiter Hartmut Haupt befürchtete, der Brand unter dem Dach könne das gesamte Haus in sich zusammenbrechen lassen.
Gegen 23 Uhr fand vor dem brennenden Gebäude ein seltsames Kolloquium statt. Ich verwende das Wort Kolloquium bewusst, weil der Austausch der Argumente durchaus wissenschaftlichen Charakter hatte. Es waren die Baufachleute, die mit der Begutachtung des Gebäudes beauftragt gewesen waren und die jetzt mit der Einsatzleitung der Feuerwehr über die Gebäudestatik diskutierten. Es war ein Glück, dass das Haus in den Wochen zuvor so intensiv wie noch nie in seiner Geschichte analysiert worden war. Die Ingenieure konnten die Feuerwehr davon überzeugen, dass die Holzbalkendecke aus dem 16. Jahrhundert, über der im 2. Obergeschoss das Feuer ausgebrochen war, stabil sei und in den nächsten Stunden nicht einbrechen werde. Es handelte sich um eine sogenannte Mann-an-Mann-Decke, die im Gegensatz zur Holzbalkendecke keine Zwischenräume zwischen den einzelnen Holzbalken hat und dank der massiven Baumstämme eine besonders hohe Tragfähigkeit besitzt.
Und dann geschah das Erstaunliche: Die Einsatzleitung der Feuerwehr ging das Risiko ein, die Fortsetzung der Bücherbergung zu erlauben. Die Feuerwehrleute halfen dabei mit an vorderster Front. Auch die anderen vor dem Haus wartenden Helfer stürmten sofort wieder in das brennende Haus und begannen, wahllos Bücher aus den Regalen zu holen und ins Tiefmagazin herunterzutragen. Auf der Treppe behinderte man sich gegenseitig durch den Gegenverkehr.
Hellmut Seemann, der Präsident der Klassik Stiftung Weimar, und ich, die wir anfangs ebenfalls rauf und runter gelaufen waren, fanden diese Methode bald zu ineffektiv und versuchten, die aufgeregten Menschen auf einem bestimmten Punkt auf der Treppe zum Stehenbleiben zu zwingen. Das war nicht leicht, denn das bedeutete für viele Helfer eine Phase der Tatenlosigkeit, die sie glaubten besser nutzen zu sollen. Schließlich waren die Kommandos von Hellmut Seemann so lautstark und überzeugend, dass endlich, anfangs lückenhaft, aber dann immer dichter, eine Menschenkette zustande kam, über die ein Buchstapel nach dem anderen oder auch ganze Umzugskisten weitergereicht werden konnten. Auf diese Weise konnten im Laufe der Nacht riesige Mengen von Büchern geborgen werden. Außerdem wurden die Menschen ruhiger und weniger hektisch, es verbreitete sich plötzlich das Gefühl eines vereinigten sinnvollen Tuns.
Immer wenn es in den politischen Diskussionen über die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in Deutschland nicht vorangeht, denke ich an diese Nacht des 2. September 2004 zurück und daran, dass es einerseits mutige Entscheidungen, wie sie damals die Feuerwehr getroffen hat, und andererseits eine solche Menschenkette braucht. Nur dann kann es gelingen, die gefährdete schriftliche Überlieferung von Generation zu Generation weiterzugeben. Sorry für die Emotion.
Michael Knoche
27. August 2018 — Wenn alles im Digitalen verschwimmt

Während früher ein gedrucktes Buch, eine Urkunde oder eine Akte jahrhundertelang unverändert Auskunft über einen bestimmten Wissensstand geben konnten, ist die Belegbarkeit des Wissens im digitalen Kontext zu einem fast unlösbaren Problem geworden. Digitale Quellen sind nicht dauerhaft erreichbar – und wenn sie es sind, sind sie nicht unbedingt authentisch, sondern können auch manipuliert sein. Dem System Wissenschaft, das zunehmend auf Digitalität setzt, droht ein verhängnisvoller Kontrollverlust.
Digitale Objekte sind leicht zu verändern, permanent zu aktualisieren, ja geradezu fluid. Manchmal handelt es sich um laufend aktualisierte Textkonglomerate, die gar keine lineare Struktur mehr haben, oder um Medien jenseits des klassischen Publikationsbegriffs, in die auch Bildergalerien, Video- und Audio-Files integriert sind. Die elektronischen Distributionswege haben außerdem dazu geführt, dass die wissenschaftlichen Verlage zumindest im Bereich Naturwissenschaft, Technik und Medizin ihre E-Journals und E-Books nicht mehr verkaufen, sondern nur noch lizenzieren. Die Bibliotheken erwerben also nur ein begrenztes Zugriffsrecht und stellen diese Zugänge ihren Nutzern zeitlich befristet zur Verfügung. Die Dateien bleiben Eigentum der Verlage.
Die Bibliotheken in Deutschland untersuchen zur Zeit verschiedene Lösungsmodelle für eine zentrale Speicherung elektronischer Ressourcen (»Hosting«). Es geht darum, einen stabilen Zugriff auf sämtliche lizenzierte und lizenzfreie digitale Publikationen in Deutschland zu gewährleisten. In den USA gibt es die Agentur Portico, die das ansatzweise leistet und sich aus Gebühren von Verlagen und Bibliotheken finanziert. Die von Verlagen zugelieferten elektronischen Dokumente werden gespeichert und können im Notfall von den Bibliotheken abgerufen werden. Aber Portico ist nicht das Ei des Kolumbus. Die Server stehen in einem Land, das den Datenschutz weniger ernst nimmt als Deutschland. Vor allem: Das System sichert nur die Mainstream-Dokumente der großen Verlage, die sich dem Unternehmen angeschlossen haben.
Wenn sich die deutschen Bibliotheken über ein Konsortium an Portico beteiligen, wie dies jetzt wahrscheinlich ist, müssen sie auch Vorkehrungen für die Publikationen schaffen, die von dieser Agentur nicht abgedeckt sind. Daher wird zusätzlich ein anderes Hostingmodell geprüft: Bei LOCKSS handelt es sich um eine Open Source Technologie zur Speicherung von Objekten auf verschiedenen Festplatten, die weltweit verteilt sind, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren. So können z.B. Zeitschriften kontinuierlich mit den Servern der Mitgliedsbibliotheken auf Authentizität abgeglichen werden. Ziel ist der Aufbau eines nationalen Netzwerks in Deutschland, um insbesondere die Produkte kleinerer Verlage und von Open Access Publikationen abzusichern. Bis dahin wird es aber noch eine Zeit dauern.
Die große Crux beider Modelle ist: Eine umfassende Langzeitarchivierung ist damit nicht verbunden. Langzeitarchivierung bedeutet, dass Dateiinhalte in ihrer originalen Nutzungsumgebung authentisch verfügbar gehalten werden. Das ist eine vertrackte Sache, weil die Betriebssysteme ebenso veralten wie die Hard- und Software. Die Langzeitarchivierung ist nicht nur ein technisches, sondern auch ein organisatorisches und finanzielles Problem. Der amerikanische Experte für Langzeiterhaltung Jeff Rothenberg charakterisiert die Lage sarkastisch: »Digital documents last forever – or five years, whichever comes first.«
In immer kürzeren Abständen müssen die Speicherkonzepte für die Langzeitsicherung überprüft und angepasst werden. Die besten Repositorien streben eine Aufbewahrungsperspektive von fünfundzwanzig Jahren an, aber ohne Gewähr. Im Kompetenznetzwerk Nestor arbeiten Bibliotheken, Archive, Museen sowie führende Experten gemeinsam am Thema Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Quellen. Aber eine ausgereifte und von den Bibliotheken gut nachnutzbare Lösung steht noch aus.
Die gedruckten Medien garantieren die Überlieferung vorläufig noch besser als die digitalen. Papier lässt sich im Zweifel kostengünstiger und einfacher restaurieren, als bits and bytes haltbar zu machen. Aber an dem Versuch und entsprechenden Pilotprojekten führt kein Weg vorbei. Das ungelöste Thema brennt den Bibliothekaren auf den Nägeln und wird sie in den nächsten Jahren immer stärker beschäftigen. Noch völlig offen ist derzeit, welche Instanz die dafür nötigen finanziellen Mittel bereitstellt, jenseits befristeter Projekte.
Es ist Sache der Bibliotheken, in den Fluss des Wissens immer wieder Staustufen einzubauen, damit sein Stand verlässlich und dauerhaft referenziert werden kann. Heute sind sie unverdrossen dabei, die Probleme der im Netz bereitgestellten Publikationen pragmatisch anzugehen – sie zu lösen, davon kann nicht die Rede sein. Die Wissenschaft braucht ein ausreichend vielfältiges Angebot und die größtmögliche Stabilität für wissenschaftliche Publikationen auch im digitalen Zeitalter.
Am 26. August 2018 fand auf dem Erlanger Poetenfest eine Diskussion zum Thema statt. Unter der Leitung von Florian Felix Weyh diskutierten Peter Glaser, Christoph Kappes und Michael Knoche.
Michael Knoche
20. August 2018 — Thüringer Literaturlandschaft

Angenommen, Herr K. muss zum Urologen, kommt ins Wartezimmer und stellt fest, da sitzen schon zwölf Patienten. Wenn Herr K. dann noch merkt, dass er vergessen hat, sich für die Wartezeit eine vernünftige Lektüre einzustecken, droht eine ernsthafte Krise. Doch es gibt einen letzten Ausweg für den modernen Menschen: Er kann mit seinem Handy oder Tablet spielen. In dieser Situation empfehle ich, einmal die Website des Literaturlandes Thüringen aufzurufen. Man vergisst sofort seine Niere, das Wartezimmer, die Zeit.
Literaturland? Der Begriff wird hier wörtlich genommen, denn alle Informationen sind auf einer Landkarte geographisch verortet. Man kann sich also statt für einzelne Themen gleich für einen bestimmten Ort mit seinen literarischen Bezügen interessieren. Bei Weimar ist das sinnlos, denn hier ballen sich die Informationen so zusammen, dass man den Überblick verliert. Aber im Fall von Kromsdorf ist es schon sehr aufschlussreich sich anzuschauen, warum diese kleine Gemeinde ein Literaturort sein soll. Da liest man dann etwas über einen gewissen Gaspard Corneille Mortaigne de Potelles (1609–47), einem Mitglied der »Fruchtbringenden Gesellschaft«, und seinem Sohn Johann Theodor, der den Schlossgarten mit 64 Büsten berühmter Personen der Weltgeschichte ausgestattet hat (32 aus dem Orient, 32 aus dem Okzident). In der Erzählung »Die Großfürstin und der Rebell« (2002) von Albrecht Börner gehört der Park zu den Schauplätzen. Aha.
Geographisch gegliedert sind außerdem die Spezialseiten zu Dichtergräbern in Thüringen, zu Literarischen Denkmalen, zu Museen und Gedenkstätten und zu zwei Friedhöfen, die im Hinblick auf tote Dichter so ergiebig sind, dass sie einzeln vorgestellt werden müssen: Der Historische Friedhof Weimar und der Nordfriedhof Jena. Wer also vergessen haben sollte, wo genau Christian August Vulpius begraben ist, findet hier rasche Belehrung.
Noch interessanter als der Einstieg über die Orte ist der Einstieg über Themen. Hier weiß man gar nicht, wo man anfangen soll: Bei der Reihe Gelesen & Wiedergelesen vielleicht? Dort finden sich Rezensionen zu aktuellen Titeln und klassischen Texten aus und über Thüringen. Auf der Seite Thüringen im literarischen Spiegel liest man, was Wilhelm von Kügelgen auf dem Weg nach Hummelshain so alles erlebt hat, wo Hans Fallada die Sense schwang und andere literarische Kabinettstückchen. Buchhändlerinnen und Buchhändler im Gespräch erlaubt Einblicke in die aktuelle Situation der Literaturvermittlungsarbeit in der Provinz.
In verschiedenen Epochenschnitten werden Einzelaspekte der Thüringer Literaturgeschichte beleuchtet. Dort kann man über Gabriele Reuter in Weimar lesen (Annette Seemann), Jakob van Hoddis in Thüringen (Wulf Kirsten), Pier Paolo Pasolinis Besuch der »Weimar-Festspiele der deutschen Jugend« 1941 (Wolfgang Haak) oder über Wolfgang Hilbigs Spuren in Meuselwitz (Volker Hanisch). An die exzellent recherchierten Informationen, die oft nur an dieser Stelle publiziert sind, schließt sich ein Spaziergang an die jeweiligen Schauplätze an.
Auf der Seite Literatur und Wandern sind zehn Texte von Schriftstellern aus dem Jahr 2017 versammelt. Jan Röhnert ist z.B. die 40 km von Weimar nach Rudolstadt abgelaufen – »Unterwegs über Großkochberg, mit Goethe ohne Charlotte«.
Die Rubrik Nachrufe & Gedenken enthält u.a. bewegende Erinnerungen an den vor ein paar Monaten verstorbenen Hans Arnfrid Astel von Christoph Schmitz-Scholemann, der den Dichterkollegen einmal im Omnibus auf der Fahrt nach Rudolstadt (schon wieder! ein sehr literarischer Ort!) kennengelernt hat. Von Astel, der in Weimar aufgewachsen ist, stammt das unvergessliche Gedicht:
Die Amsel fliegt auf.
Der Zweig winkt ihr nach.Neben dem nützlichen und gut gepflegten Veranstaltungskalender (samt Archiv) stellt die Personensuche die vierte Großrubrik dar. Hier können 400 Persönlichkeiten aus Vergangenheit und Gegenwart, die etwas mit Thüringens Literatur zu tun haben, aufgerufen werden. Mit den bio-bibliographischen Angaben verbunden sind oft Originaltexte der Autoren, wie etwa Peter Gülkes Liebeserklärung »Auf Weimarer Parkwegen«.
Trotzdem findet man hier nicht alle Thüringer Gegenwartsautoren. Das Autorenlexikon auf der Seite des Thüringer Literaturrates scheint kompletter zu sein. Dort entdeckt man auch die wunderbare Audiobibliothek, eine allmählich wachsende Anthologie zeitgenössischer Lyrik und Prosa aus Thüringen, gesprochen von den Schriftstellern selber. Sie würde auch auf die Seite der Thüringer Literaturandschaft passen.
Beide Websites werden vom Thüringer Literaturrat e.V. betrieben, dessen Vorsitzender Christoph Schmitz-Scholemann ist. Derjenige, der die Seiten mit Inhalt füllt, ist Jens Kirsten, den man dafür nicht genug loben und preisen kann. Die Seite des Literaturlandes Thüringen ist sensationell gut gemacht und steht auch im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Die Wartezeit beim Urologen kann gar nicht lang genug sein.
http://www.literaturland-thueringen.de/
Michael Knoche
13. August 2018 — Sechs Fragen, sechs Antworten
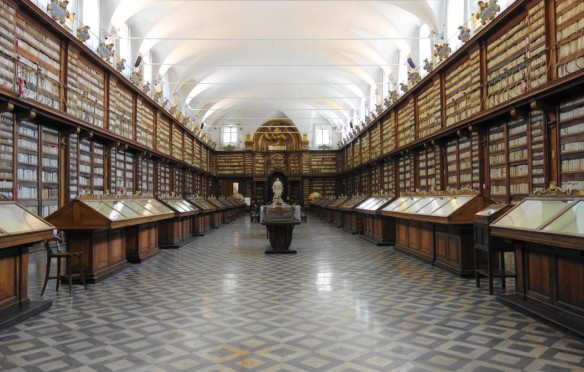
Herr Knoche, historisch gesehen waren Bibliotheken immer dafür zuständig, Wissen zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Heute macht das Internet der Öffentlichkeit Wissen jederzeit und überall zugänglich. Trotzdem stellen Sie in Ihrem Buch die These auf, dass die Idee der Bibliothek nach wie vor unbedingt notwendig sei. Warum braucht es aus Ihrer Sicht auch in der Zukunft weiterhin analoge Bibliotheken?
Internet und Bibliothek sind kein Gegensatz. Wenn man schnell Auskunft über bestimmte Fakten braucht, ist das Internet das geeignete Medium. Aber vieles gibt es gar nicht digital, oder es gab es mal und ist wieder verschwunden, anderes ist hinter Bezahlschranken versteckt. Daher braucht es Bibliotheken. Sie stellen das gesamte Spektrum an Medien bereit: Bücher, elektronische Zeitschriften, Musiknoten, Bildbände und Datenbanken, kurzum: alles von Relevanz für Wissenschaft, Bildung und demokratische Öffentlichkeit. Bibliotheken als physische Orte bieten einen geordneten Überblick über dieses Spektrum, Beratung, Möglichkeiten zur Interaktion mit anderen, Inspiration.
Geschichte und Diskurse finden aber heute zusehends in sozialen Netzwerken statt, auch weltgeschichtlich relevante Ankündigungen – dafür reicht ein Blick in den Twitter-Account von Donald Trump. Wäre es nicht die Aufgabe von Bibliotheken, diese für die Recherche und die Nachwelt bereitzustellen, auch analog?
Wenn die Bibliotheken damit anfingen, auch die Kommunikation der Menschen zu dokumentieren, würden sie ihren Zweck verfehlen. Sie sind ja keine gewaltigen Spiegelbilder unseres alltäglichen Lebensvollzugs. Bibliotheken konzentrieren sich auf Wissen, das einen gewissen Reifegrad erreicht hat und z.B. in Buchform oder in seriösen elektronischen Quellen vorliegt. Ihr Objekt ist die Publikation, nicht die Kommunikation. Übrigens werden die Twitter-Meldungen von Donald Trump von den National Archives and Records Administration, Washington D.C., gespeichert.
In Ihrem Buch formulieren Sie die These, dass die Idee der Bibliothek durch die elektronischen Medien nicht gefährdet, sondern – ganz im Gegenteil –, noch machtvoller werde. Inwiefern unterstützen elektronische Medien die Macht der Bibliothek?
Na ja, Macht ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Aber Bibliotheken besetzen eine Lücke, um die sich sonst niemand kümmert: das Problem der dauerhaften Zugänglichkeit aller Medien, sowohl der gedruckten Überlieferung, als auch der digitalen Publikationen. Jedenfalls interessiert das die Hersteller nur in zweiter Linie. Bibliotheken haben dafür zu sorgen, dass das Wissen umfassend, neutral, verlässlich und weitgehend kostenfrei zugänglich bleibt, auch langfristig. Kann man sich im Ernst eine Gesellschaft vorstellen, zumindest eine, in der man leben möchte, die dies für verzichtbar hält?
Sollten Bibliotheken sich in Zukunft weiterhin auf Bücher und klassische Print-Datenträger beschränken oder müssen sie, wie beispielweise das Goethe-Institut in Bratislava, neben Büchern auch andere Gegenstände zum Ausleihen bereitstellen, wie z.B. Kinderspielzeug?
Aber Bibliotheken beschränken sich schon lange nicht mehr auf gedruckte Bücher! Sie ergreifen nicht Partei für das eine und gegen das andere Medium. Sie sollten sich aber auf Medien des Wissens beschränken. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten besteht die Gefahr, sich zu verzetteln.
Blicken wir einmal jenseits der Debatte um die Digitalisierung: Sie plädieren für Bibliotheken in einem System, für eine Vernetzung untereinander. Dies ist mit der Fernleihe aber doch beispielsweise schon gegeben. Was haben die Bibliotheken und deren Nutzer von dem geforderten Bibliothekssystem?
Keine Bibliothek kann angesichts der Fülle des produzierten Wissens ohne das Netzwerk anderer Bibliotheken auskommen. Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo man vielleicht noch hoffen konnte, dass eine Bibliothek alle für ein bestimmtes Fachgebiet relevante Publikationen vorrätig hält. Das Wissen ist heute global unterwegs, sodass sich Bibliotheken abstimmen müssen, wer sich um was kümmert. Es fehlt in Deutschland eine kluge Koordinierung durch die Politik. Die Bibliotheken gehören meist den Bundesländern oder den Städten. Im Bund gibt es keine Instanz, die den Anstoß zu gemeinsamer Planung und Zusammenarbeit gibt. So werden die Gemeinschaftsaufgaben vernachlässigt, und eine Arbeitsteilung unter den Bibliotheken findet viel zu wenig statt. Die einzelnen Nutzer würden davon profitieren, wenn die Bibliotheken im System leistungsfähiger würden.
In der Wirtschaft spricht man gerne von »Best-Practice-Beispielen«, wenn etwas besonders gut und nachahmenswert erscheint. Wie sieht dies in der Bibliothekslandschaft aus: Wer ist da deutschland- und weltweit für Sie ein Musterschüler?
In Deutschland macht die Bayerische Staatsbibliothek z.B. eine sehr gute Arbeit. International ist die Library of Congress in Washington D.C. vielleicht die stärkste Bibliothek. Aber nicht nur die ganz Großen, auch die innovativen spezialisierten Bibliotheken sind wichtig. Wenn man mir den Hinweis in (ehemals) eigener Sache nicht übelnimmt: Ich finde, dass auch die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar beachtenswert ist. Mein Tipp: Gehen Sie in jede Bibliothek hinein, die Ihnen in die Quere kommt und interessant erscheint. Bibliotheken sind öffentlich. Schauen Sie sich um! Wenn Sie lange keine Bibliothek mehr von innen gesehen haben, werden Sie staunen, wie sehr sich Bibliotheken gewandelt haben und was sie alles zu bieten haben.
Die Fragen stellte Franziska Sieb für das Murmann-Magazin
Michael Knoche
